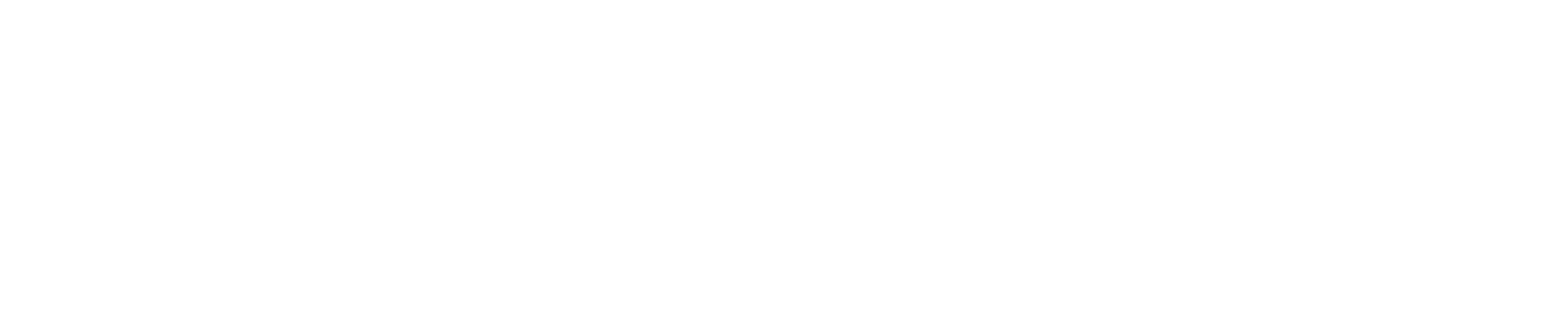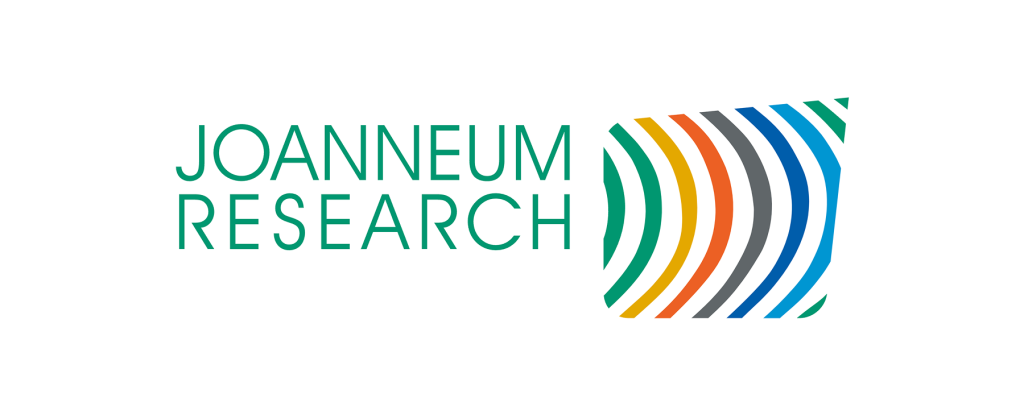PASSAT unterstützt österreichische Unternehmen bei der Umsetzung des Digitalen Produktpasses, um nachhaltiges Wachstum durch Kreislaufwirtschaft und innovative Produktionsprozesse zu fördern. Durch die Bereitstellung verlässlicher Produktdaten entlang des gesamten Lebenszyklus ermöglicht der DPP die Reduktion von Abfall, eine längere Produktnutzung und neue Geschäftsmodelle.
Das Projekt entwickelt praxisnahe Lösungen, regulatorische Empfehlungen sowie Schulungsmaterialien und setzt Pilotprojekte in den Bereichen Textilien, Elektronik und Skiindustrie um. In enger Zusammenarbeit mit Industrie, Forschung und politischen Akteuren schafft PASSAT die Grundlage für eine breite Einführung von DPPs in Österreich – für mehr Nachhaltigkeit und wirtschaftlichen Erfolg.
Informationen zum DPP
Auf dieser Seite finden Sie allgemeine Informationen zum Digitalen Produktpass (DPP) sowie zur Ökodesign-Verordnung (ESPR). Die Inhalte werden laufend aktualisiert, um Sie stets auf dem neuesten Stand zu halten.
Zu Beginn erhalten Sie einen Überblick über den aktuellen Stand der Entwicklungen. Im weiteren Verlauf der Seite finden Möglichkeiten sich einzubringen, und eine Vielzahl an Links zu relevanten Webseiten und Veröffentlichungen. Unter anderem sind hier auch die Nachberichte der DPP Check-Ins verlinkt. Diese Online-Veranstaltungen finden etwa alle zwei Monate statt und dauern jeweils eine Stunde. Zu Beginn jedes Check-Ins gibt es ein Update zum DPP („Was ist seit dem letzten Check-In passiert?“), gefolgt von kurzen Fachvorträgen von Vertreterinnen und Vertretern aus der DPP-Community. Die Anmeldung zu den Check-Ins erfolgt über die PASSAT-Stakeholder-Plattform. Weiter unten auf dieser Seite finden Sie die Nachberichte aller bisherigen Check-Ins – der jeweils letzte enthält die aktuellsten Informationen.
Aktueller Stand & relevante Informationen
Die Einführung des Digitalen Produktpasses (DPP) stellt ein zentrales Instrument der europäischen Produktpolitik im Rahmen des Green Deals dar. Seine rechtliche Grundlage bildet die Ökodesign-Verordnung (ESPR – Ecodesign for Sustainable Products Regulation), die am 18. Juli 2024 in Kraft trat. Diese Verordnung fungiert als Rahmenverordnung: Sie legt grundlegende Prinzipien fest, definiert jedoch noch keine konkreten Anforderungen an Unternehmen. Diese werden in den kommenden Jahren in produktspezifischen Verordnungen, sogenannten delegierten Rechtsakten, ausgestaltet. Ziel der ESPR ist es, den ökologischen Fußabdruck von Produkten über deren gesamten Lebenszyklus zu verringern sowie Transparenz und Nachverfolgbarkeit in Wertschöpfungsketten zu verbessern. Der DPP ist ein zentraler Baustein dieser Strategie.
Gesetzlicher und regulatorischer Rahmen
Im April 2025 wurde der erste Arbeitsplan für den Zeitraum 2025–2030 veröffentlicht. Dieser legt fest, welche Produktgruppen und horizontalen Themenbereiche in den nächsten fünf Jahren priorisiert werden. Ab 2026 sollen sowohl produktspezifische als auch horizontale Anforderungen in Form delegierter Rechtsakte erarbeitet und finalisiert werden. Für diese Rechtsakte gilt in der Regel eine Übergangsfrist von 18 Monaten nach Veröffentlichung, bevor sie verbindlich werden.
Laut aktuellem Arbeitsplan der Europäischen Kommission (April 2025) wurden folgende Produktgruppen für die kommenden Jahre identifiziert:
Eisen und Stahl (Zwischenprodukt)
Aluminium (Zwischenprodukt)
Textilien und Bekleidung (Endprodukt)
Möbel (Endprodukt)
Matratzen (Endprodukt)
Reifen (Endprodukt)
Die horizontalen Maßnahmen beziehen sich auf:
Reparierbarkeit
Recyclingfähigkeit, bzw. Anteil an recyceltem Material (Rezyklatanteil)
Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) ist derzeit nicht als eigenständige Produktgruppe ausgewiesen, wird jedoch im Rahmen der horizontalen Anforderungen mitberücksichtigt.
Energieverbrauchsrelevante Produkte: 16 der bislang 35 unter der bisherigen Ökodesign-Richtlinie geregelten Gruppen werden in die neue Verordnung überführt und dort aktualisiert.
Zeitlicher Fahrplan für die Einführung des DPP
Die Tabellen im Arbeitsplan zeigen die geplante zeitliche Abfolge der Umsetzung für verschiedene Produktgruppen. Bitte beachten Sie: Der Fahrplan ist eine grobe Abschätzung – Änderungen sind möglich.
Neben der ESPR gibt es weitere EU-Verordnungen, die den DPP als zentrales Informationsinstrument definieren:
Batterieverordnung: Einführung des digitalen Batteriepasses ab Februar 2027.
Das BatteriePass-Projekt bietet eine umfassende Übersicht zu den Anforderungen.Bauprodukte-Verordnung: Vorgesehen ist ein digitaler Produktpass ab ca. 2028.
Weitere relevante Verordnungen mit DPP-Bezug: Spielzeug-Verordnung, Detergenzien-Verordnung u.v.m.
Inhaltliche Anforderungen an den DPP
Welche Informationen in welchen Produktgruppen und in welchem Umfang erforderlich sein werden, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Die Ökodesign-Verordnung definiert jedoch bereits 16 sogenannte Ökodesign-Kriterien, die die Grundlage für die inhaltlichen Anforderungen des DPP bilden. In den künftig auszuarbeitenden produktspezifischen Verordnungen wird festgelegt, welche dieser Kriterien in welchem Umfang für welche Produkte verpflichtend anzuwenden sind:
Funktionsbeständigkeit und Zuverlässigkeit
Wiederverwendbarkeit, Reparierbarkeit und Nachrüstbarkeit
Wartung und Instandsetzungsmöglichkeiten
Vorhandensein gefährlicher oder besorgniserregender Stoffe
Energie- und Wasserverbrauch sowie Effizienz
Ressourceneinsatz und Ressourceneffizienz
Anteil an recycelten Materialien (Rezyklatanteil)
Wiederaufarbeitbarkeit, Recyclingfähigkeit und stoffliche Verwertbarkeit
Umweltauswirkungen, inklusive CO₂-Fußabdruck
Abfallaufkommen
Standardisierung des DPP
Neben der Frage nach dem „Was“ – oft als DPP-Daten bezeichnet – gibt es einen zweiten zentralen Aspekt bei der Umsetzung des DPP: das „Wie“, auch als DPP-System bezeichnet. Diese beiden Komponenten bilden gemeinsam die Grundlage für die Implementierung des Digitalen Produktpasses. Das „Wie“ bezieht sich dabei vor allem auf die IT-Architektur sowie die technischen Standards rund um den DPP. Zur Erarbeitung dieser Standards wurde CEN/CENELEC im Rahmen eines Standardisierungsauftrags beauftragt, harmonisierte europäische Normen für den DPP zu entwickeln. Diese sollen bis Ende 2025 finalisiert und im Frühjahr 2026 offiziell veröffentlicht werden.
Seit Ende Juni 2025 liegen die ersten fünf von insgesamt acht sogenannten Inquiry Drafts für diese harmonisierten Standards vor. Die Koordination der nationalen Beiträge erfolgt in Österreich über Austrian Standards International (ASI). In Österreich wurden die Entwürfe von ASI im Normenportal veröffentlicht und standen dort bis Mitte August 2025 zur öffentlichen Kommentierung bereit. Die Ausarbeitung dieser Normen ist von zentraler Bedeutung, da sie die technische Grundlage für eine einheitliche und interoperable Einführung des DPP in Europa schaffen. Vor dem Hintergrund der begrenzten Transparenz innerhalb der Normungsgremien und der Komplexität der Inhalte fand am 05.08.2025 ein Webinar statt, das Akteur:innen aus Industrie, Normung und Regulierung einen strukturierten Überblick sowie eine fundierte Einordnung der Inhalte bieten soll. Weitere Informationen und die Aufzeichnung des Webinars finden Sie HIER.
Ausblick
Der DPP entwickelt sich schrittweise zu einem zentralen Element europäischer Produktregulierung – mit weitreichenden Folgen für Lieferketten, Nachhaltigkeitsbewertungen und regulatorische Pflichten. Dies zeigt sich auch in den aktuellen Veröffentlichungen zu Omnibus IV und der Single Market Strategy: Während zunächst angenommen wurde, dass der DPP bzw. die Ökodesign-Verordnung in diesen Kontexten eingeschränkt werden könnte, zeigt sich nun das genaue Gegenteil – die Bedeutung des DPP nimmt weiter zu:
“The Digital Product Passport (DPP) will become the main tool for disclosing and sharing product information across all new and revised product legislation…”
Die Kombination aus produktspezifischen Anforderungen und horizontalen Nachhaltigkeitszielen macht den DPP zu einem ambitionierten Vorhaben, das Unternehmen frühzeitig in ihre strategische Planung integrieren sollten. Die laufenden Standardisierungsprozesse und die bevorstehenden delegierten Rechtsakte werden entscheidend für eine kohärente, interoperable und effektive Umsetzung sein.
Möglichkeiten sich einzubringen
Die Entwicklung und Umsetzung des DPP ist ein offener und dynamischer Prozess, bei dem verschiedene Akteure mitwirken können – von Unternehmen über Verbände bis hin zur Wissenschaft. Im Folgenden finden Sie einen Überblick über selektive Möglichkeiten zur Beteiligung:
- Ecodesign Forum der Europäischen Kommission:
Das Ecodesign Forum ist eine offizielle Plattform der Europäischen Kommission, über die Stakeholder Rückmeldungen zu geplanten Maßnahmen im Rahmen der Ökodesign-Verordnung geben können. Hier werden politische Entwicklungen diskutiert und Empfehlungen formuliert. In Österreich sind beispielsweise Mitarbeitende der WKÖ (Wirtschaftskammer Österreich) und des FMTI (Fachverband der Maschinen- und Metallwarenindustrie) über europäische Dachverbände in dieses Forum eingebunden. Eine direkte Teilnahme einzelner Unternehmen ist aktuell nicht vorgesehen, die Einbindung kann über die Verbände erfolgen. Nähere Infos zum Ecodesign Forum gibt es HIER.
- Forschungs- und Umsetzungsprojekte:
Es gibt bereits zahlreiche europäische und nationale (Forschungs-)Projekte, die sich mit dem DPP befassen. Diese Projekte bieten häufig Informationen, Webinare, Workshops oder Leitfäden an und unterstützen Unternehmen bei der Vorbereitung auf den DPP. Indirekt können Sie durch die Teilnahme an Umfragen, Interviews oder Workshops zu diesen Projekten beitragen, die oft in (politische) Empfehlungen resultieren.
Das zentrale europäische Leitprojekt in diesem Bereich ist CIRPASS-2. Es koordiniert die Vorbereitung des DPP auf EU-Ebene. Interessierte können sich über Stakeholder-Gruppen, Konsultationen und Befragungen aktiv einbringen. Auf der circulardata-Plattform gibt es außerdem die Möglichkeit, sich mit weiteren Akteuren im DPP-Umfeld auszutauschen, sowie Informationen und Lösungen zu teilen. In Österreich gibt es neben spezifischeren DPP-Projekten zwei Leitprojekte, PASSAT und PACE. Näheres zur Einbindung von Stakeholdern im PASSAT-Projekt finden Sie im Reiter „TBA“.
- Wirtschaftskammern & Fachverbände:
Die WKÖ sowie einzelne Fachverbände fungieren als zentrale Anlaufstellen, um Feedback zu Entwicklungen im Rahmen von ESPR und DPP zu sammeln und gebündelt an europäische Institutionen weiterzugeben. Unternehmen können sich über diese Organisationen einbringen oder Unterstützung bei offenen Fragen erhalten. Die Übersichtsseite der WKÖ, sowie Infos zu deren Webinarreihe finden Sie HIER.
- Standardisierung:
Ein zentraler Baustein für die Einführung des DPP ist die Entwicklung technischer Standards. Seit Juni/Juli 2025 liegen die ersten sogenannten Enquiry Drafts (Entwürfe harmonisierter europäischer Normen) vor. Über nationale Standardisierungsgremien – in Österreich Austrian Standards – können interessierte Personen oder Organisationen direkt Feedback zu diesen Entwürfen geben. Die Konsultationsphase läuft je nach Gremium bis etwa Mitte August 2025. Auf diesem Weg können Sie aktiv an der technischen Ausgestaltung des DPP mitwirken.
- „Have Your Say“- Plattform der Europäischen Kommission:
Über die Plattform Have Your Say können Sie offizielle Rückmeldungen zu Gesetzesvorschlägen und Verordnungsentwürfen der EU-Kommission geben – auch zu DPP-relevanten Dokumenten wie der ESPR oder produktspezifischen Rechtsakten. Die Beiträge werden von der Kommission gesammelt und ausgewertet. Zusätzlich dazu gibt es zu spezifischen Aspekten der Verordnung, zuletzt beispielsweise zum Thema Rules for Service Providers gesonderter Feedback-Möglichkeiten (Call for Evidence). Informationen zu aktuellen Feedback-Möglichkeiten gibt es immer in den DPP Check-Ins.
- Vorbereitende Arbeiten (Preparatory Studies)
Bevor die eigentlichen delegierten Rechtsakte ausgearbeitet werden, finden sogenannte Preparatory Studies statt. Derzeit laufen solche Studien für die Produktgruppen Eisen & Stahl sowie Textilien. Auf den jeweiligen Webseiten können Sie sich über aktuelle Entwicklungen informieren und an den geplanten Veranstaltungen teilnehmen.
- Webinare & Veranstaltungen (v.a. der EU-Kommission):
Die Europäische Kommission und andere Organisationen bieten regelmäßig Webinare und Informationsveranstaltungen zum DPP und ESPR an. Zwar sind diese nicht immer als formale Beteiligungsmöglichkeiten ausgelegt, jedoch können dort relevante Fragen gestellt und Diskussionen angestoßen werden. Oft fließen diese Rückmeldungen auch informell in weitere Entwicklungen ein. In den DPP Check-Ins informieren wir regelmäßig über kommende Events.
Links
Offizielle Dokumente & Seiten
- Ökodesignverordnung
- Standardisation Request
- Batterieverordnung
- Übersicht Produktspezifische Arbeiten in der Kommission (Product Bureau)
- Link zum Ecodesign Forum
- Vorarbeiten im Bereich Textilien
- Vorarbeiten im Bereich Eisen & Stahlprodukte
- Erster Arbeitsplan der Europäischen Kommission
- Präsentation zum ersten Arbeitsplan
Weiterführende Informationen
- DPP Fact Sheet
- PACE Projekt
- DPP Playbook
- CIRPASS-2 Projekt
- circulardata-Plattform
- WKÖ ESPR Webinarreihe
DPP Check-Ins
- Check-In #1: 16.01.2024
- Check-In #2: 04.03.2024
- Check-In #3: 18.04.2024
- Check-In #4: 27.05.2024
- Check-In #5: 02.07.2024
- Check-In #6: 09.09.2024
- Check-In #7: 19.11.2024
- Check-In #8: 19.02.2025
- Check-In #9: 07.04.2025
- Check-In #10: 25.06.2025 – Dieser Check-In umfasst die neuesten Informationen zum DPP und viele Links zu weiteren Informationen.
Der Digitale Produktpass (DPP) soll künftig eine zentrale Rolle für mehr Transparenz entlang der Wertschöpfungskette von Produkten spielen. Verankert in der Ökodesign-Verordnung (ESPR) auf EU-Ebene, werden im DPP künftig Produktinformationen digital erfasst, gespeichert und maschinenlesbar zugänglich gemacht. Im Fokus stehen dabei insbesondere Nachhaltigkeitsdaten – etwa zu Materialien, Reparierbarkeit, CO₂-Fußabdruck oder Recyclingfähigkeit.
Der DPP gilt als ein wesentlicher Baustein für die Umsetzung einer zirkulären Wirtschaft. Er soll jedoch nicht nur regulatorische Anforderungen erfüllen, sondern auch als zentrale Informationsinfrastruktur für weitere produktbezogene Regulierungen dienen. Ziel ist es, langfristig Berichtspflichten zu vereinfachen, Effizienz in der Datennutzung zu steigern und neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen.
Aktuell bestehen jedoch noch zahlreiche offene Fragen zur konkreten Ausgestaltung und Umsetzung des DPP, da die genaue Ausgestaltung noch in Arbeit ist. Eins ist jedoch fix, aber 2027 sollen die ersten DPPs für Batterien verpflichtend werden, danach folgen weitere Produktgruppen. Mehr Details zum aktuellen Stand finden Sie unter Informationen zum DPP.
Die praktische Umsetzung des Digitalen Produktpasses stellt für viele Unternehmen eine erhebliche Herausforderung dar. Einerseits werden viele der künftig geforderten Datenpunkte bislang nicht systematisch erfasst, und es fehlt häufig an Transparenz in komplexen Lieferketten. Andererseits ist der Digitalisierungsgrad zahlreicher Prozesse noch nicht ausreichend, um die Anforderungen des DPP zuverlässig zu erfüllen. Umso wichtiger ist eine gezielte Unterstützung von Unternehmen bei diesem strukturellen Wandel.
Genau hier setzt PASSAT – Digital Product Passport Austria & Beyond an: Als österreichisches Leuchtturmprojekt begleitet PASSAT insbesondere heimische Unternehmen bei der Vorbereitung auf die kommende Regulatorik. Dabei geht es nicht nur um die Einhaltung zukünftiger Anforderungen, sondern auch um die strategische Nutzung des DPP als Werkzeug für Kreislauffähigkeit und nachhaltige Geschäftsmodelle. Denn, für den Industriestandort Österreich ist es entscheidend, die Transformation aktiv mitzugestalten, um nicht nur Schritt zu halten, sondern eine Vorreiterrolle in Europa einzunehmen.
Projektziele
- Unternehmen unterstützen: Gezielte Unterstützung und Trainings zur Umsetzung des DPP und Aufbau einer Stakeholder-Gruppe
- Rahmenwerk und Technologie-Exploration: Entwicklung eines generischen Ansatzes für den DPP und Untersuchung unterstützender Technologien – mit besonderem Fokus auf Datenräume und weitere Lösungsansätze
- Politik & Standards: Erarbeitung von Empfehlungen zur Gestaltung nationaler sowie internationaler Richtlinien und Standards
- Praktische Demonstration: Entwicklung eines minimal funktionsfähigen Digitalen Produktpasses (MVP) und Anwendung in drei Use Cases: Textilien, Elektronik und Skiindustrie
- Fokus Kreislaufwirtschaft: Förderung des DPP für nachhaltige Produktlebenszyklen wie Wiederverwendung und Recycling
Use Cases
Use Case Textilien
Textilien gehören zu den ersten Produktgruppen, die durch die Ökodesign-Verordnung erfasst werden und aufgrund ihres hohen Umwelteinflusses sowie ihrer komplexen Lieferketten einen DPP benötigen. PASSAT geht diese Herausforderungen gemeinsam mit den Herstellern Löffler und Grabher an und entwickelt DPPs sowohl für Bekleidungs- als auch für Nicht-Bekleidungs-Produkte. Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf der Erfassung und Strukturierung von Daten entlang der fragmentierten Liefernetzwerke. Um den DPP physisch mit dem Produkt zu verknüpfen, untersucht PASSAT gemeinsam mit dem Projektpartner Silana Technologien für Datenträger, darunter nahtintegrierte Identifikatoren. Die assoziierten Partner Fussl und Lenzing bringen Anwendungsfälle aus dem Einzelhandel, der Wiederaufbereitung und dem Faserrecycling ein, bei denen DPP-Daten genutzt werden.
Use Case Elektronik
Elektronikprodukte stehen im Fokus der Ökodesign-Verordnung aufgrund ihrer kurzen Lebenszyklen, ihres hohen Ressourcenverbrauchs und niedriger Recyclingquoten. PASSAT unterstützt die Umsetzung, indem es gemeinsam mit den Herstellern Fronius und EAW Digitale Produktpässe für elektronische Bauteile und Systeme entwickelt. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Strukturierung von Lebenszyklusdaten gemäß internationaler Standards (z. B. Asset Administration Shell), um einen maschinenlesbaren und benutzerfreundlichen Zugriff zu ermöglichen und so eine nahtlose Integration in digitale Wertschöpfungsketten zu fördern. Anwendungsbereiche umfassen Produktdokumentation, Umweltinformationen und Service-Daten. Die digitale Plattform Secontrade bringt Anwendungsfälle zu Wiederverwendung, Reparatur und Recyclingstrategien ein, die auf DPP-Daten basieren.
Use Case Übertragbarkeit Skiindustrie
Die Skiindustrie ist derzeit nicht vorrangig in der Ökodesign-Verordnung berücksichtigt, bietet jedoch ein nahezu unerschlossenes Feld, um die Anwendbarkeit des DPP in nicht regulierten Branchen zu erforschen. PASSAT nutzt diesen Use Case, um die Übertragbarkeit von DPP-Konzepten zu bewerten – mit Fokus auf den wirtschaftlichen Nutzen, die Umsetzbarkeit und die Integration in bestehende Produktionsprozesse. Gemeinsam mit den Herstellern Atomic und Wintersteiger trägt dieser Anwendungsfall dazu bei, Wege für eine breitere Akzeptanz des DPP über die ESPR-Prioritätssektoren hinaus zu identifizieren.
Über PASSAT
Projektpartner
PACE-DPP
Neben dem Projekt PASSAT wird mit PACE-DPP ein weiteres Leuchtturmprojekt zum Digitalen Produkt Pass in Österreich umgesetzt.
Das Projekt verfolgt einen industrie- und praxisnahen Ansatz und konzentriert sich auf zwei Use Cases – E/E-Geräte und Holz/Papier. Ziel ist es, regulatorische Anforderungen mit technologischen Möglichkeiten in Einklang zu bringen und die Einführung von Daten-Service-Ökosystemen für den Digitalen Produkt Pass vorzubereiten.
Die Schwerpunkte von PACE-DPP:
- Rahmenbedingungen und Regulierung: Evidenzbasierte Empfehlungen zur beschleunigten Markteinführung des Digitalen Produkt Passes.
- Technologien in der Praxis: Erprobung von Schlüsseltechnologien wie Datenräumen und Digitalen Zwillingen in realen Lieferketten.
- Policy & Standardisierung: Unterstützung von Regulierungsbehörden und Standardisierungsinitiativen mit konsolidierten Erkenntnissen.
- Offenes Daten-Service-Ökosystem: Aufbau einer Plattform mit leicht zugänglichen DPP-Diensten, die neue Geschäftsmodelle ermöglichen.
- Kreislaufwirtschaft: Förderung von Wiederverwendung, Reparatur und Recycling als Beitrag zum Europäischen Green Deal.
Die beiden Use Cases im Überblick:
- E/E-Geräte: Rückverfolgbarkeit elektronischer Komponenten, Reparatur und Wiederaufbereitung sowie innovative Services wie State-of-Health-Monitoring für Batterien.
- Holz/Papier: Optimierung von Materialflüssen, Förderung nachhaltiger Forstwirtschaft und Recycling, mehr Transparenz entlang komplexer Lieferketten.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website: https://dpp-austria.at/ und auf LinkedIn.